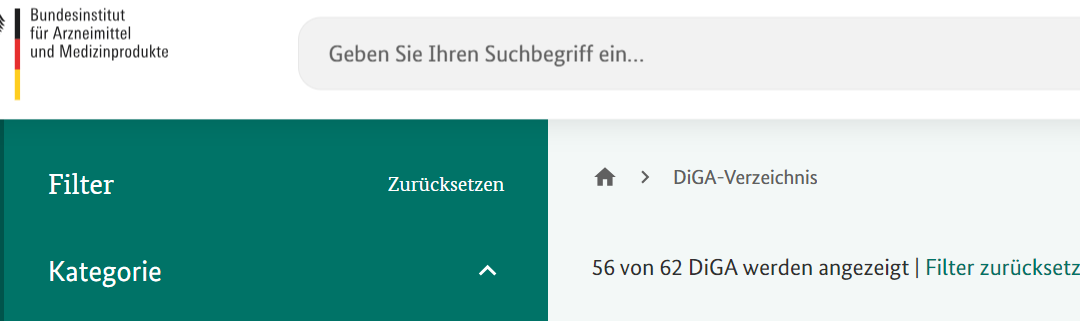Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) gelten als wichtiger Baustein einer modernen und patientenorientierten Medizin. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) begrüßt diie mit dem DiGA-Verzeichnis geschaffene Möglichkeit, digitale Innovationen reguliert und erstattungsfähig in die Versorgung zu integrieren. Zugleich warnt die Fachgesellschaft in einer aktuellen Stellungnahme davor, die Potenziale dieser Anwendungen durch fehlende
Forschungsförderung und eine zu starke Preisregulierung zu gefährden.
„Mit dem DiGA-Konzept hat Deutschland international Maßstäbe gesetzt. Damit diese Innovation dauerhaft in der Regelversorgung etabliert werden kann, sind eine solide wissenschaftliche Evidenzbasis und verlässliche Förderstrukturen unerlässlich“, sagt Professor Dr. med. Georg Ertl,Generalsekretär der DGIM aus Würzburg. Aktuell sind 56 Anwendungen im DiGA-Verzeichnis gelistet, doch die Verordnungszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere die Kosten und der teils unzureichend belegte Nutzen werden kritisiert. „Damit DiGAs ihr Potenzial entfalten können, müssen ihre positiven Versorgungseffekte in methodisch hochwertigen klinischen Studien belegtwerden. Für viele kleinere Unternehmen oder Startups ist das kaum zu stemmen“, sagt Professor Dr. med. Martin Möckel, Vorsitzender der DGIM-Projektgruppe „DiGA/KIin Leitlinien“ von der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die DGIM spricht sich für gezielte Forschungsprogramme aus, etwa beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) oder beim Innovationsfonds, die klinische Studien zu DiGA in Kooperationen zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Herstellern fördern sollten.
Fehlende Fördermechanismen und Vergütungsanreize
Während für klassische Arzneimittel und Medizinprodukte etablierte Fördermechanismen bestehen, werden solche Strukturen für digitale Gesundheitsanwendungen bislang zu wenig genutzt. Zudem sollten ärztliche Leistungen, die durch DiGAs entstehen, angemessen vergütet werden. Die gegenwärtige Situation führe dazu, dass innovative aber aufwendig zu verordnende und betreuende Anwendungen seltener genutzt werden.
Aus Sicht der DGIM bedarf es eines konzertierten politischen und wissenschaftlichen Vorgehens, um
DiGAs dauerhaft in die evidenzbasierte Medizin zu integrieren. „Gezielte Förderprogramme wären ein
notwendiger Schritt, um qualitativ hochwertige Studien zu ermöglichen und die Weiterentwicklung
digitaler Medizinprodukte zu sichern“, so Möckel. (Gesamte Stellungnahme)
Quelle: DGIM